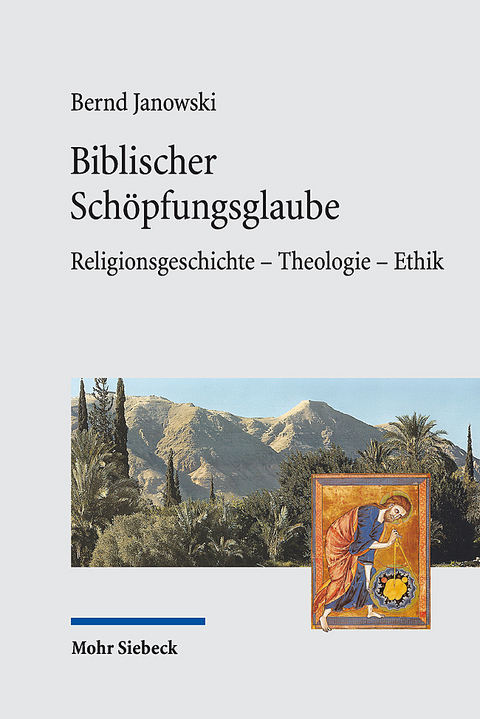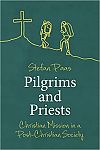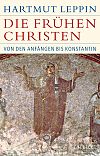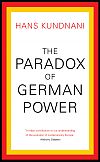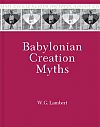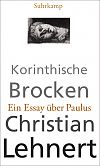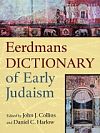Buch des Monats: Mai 2024
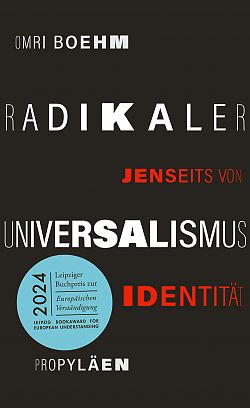
Boehm, Omri
Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität.
Berlin: Propyläen Verlag (Ullstein) 2022. 176 S. Geb. EUR 22,00. ISBN 9783549100417
Der Kosmopolit Omri Boehm, Associate Professor für Philosophie und Chair of the Philosophy Department an der New School for Social Research in New York und sowohl israelischer als auch deutscher Staatsbürger, erhielt für dieses Buch den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2024. Sein Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die »Idee des Universalismus«. Dabei bezieht er sich vor allem auf Vorstellungen Immanuel Kants, der die »metaphysische Menschheitsidee« des Monotheismus, wie sie sich spätestens seit den biblischen Propheten zeigt, ins »säkulare Denken« übersetzt und die »Idee der Menschheit« erstmals als moralischen Begriff formuliert habe (16). In ihrer Laudatio auf der Leipziger Buchpreisverleihung hebt die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz zu Recht hervor, dass B.s »Radikaler Universalismus« ein Mittel gegen die »epistemologischen und moralischen Krankheiten unserer Zeit« ist: gegen den »verzweifelten Antihumanismus der Linken« und den »ängstlichen Posthuma¬nismus der Mitte«. Und B. selbst betont in seiner Dankesrede, dass die »Logik von Brüderlichkeit und Identität« davon abhängt, »was man mit anderen gemeinsam hat und nicht vom Unterschied zu ihnen«. B. richtet sich klar gegen andere Menschen oder Gruppen ausschließende Identitäts¬politik, sei es rechte, links-woke oder jüdisch-zionistische. Der deutsche Bundeskanzler unterstützt diese Position in seiner Rede zur Buchpreisverleihung vorsichtig, indem er sagt: »Ich habe von Lesen als Zulassen gesprochen, als täglich praktizierte Bereitschaft, die eigene Perspektive infrage zu stellen, seine eigene Blase zu verlassen, sich an die Stelle des anderen zu begeben. Diese Bereitschaft ist und bleibt gerade jetzt wichtig. Sie ist essenziell für unsere Demokratie.«
Neben Kants Definition der Aufklärung als »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« und der Pflicht zum »Selbstdenken« rekurriert B. auf die US-amerikanische Unab¬hängigkeits¬erklärung. Wichtig ist B., dass es hier nicht nur um »Freiheit«, sondern auch um »die Wahrheit als treibende Kraft des amerikanischen Traums« geht (»Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht …«). Verraten haben diesen Traum s. E. die Vertreter eines Liberalismus (von John Dewey bis John Rawls, von Richard Rorty bis Mark Lilla oder Jill Lepore), den er auch als »falschen Universalismus« bezeichnet. Das »Falsche« sieht B. darin, dass viele liberale Denker eine Idee von Menschheit proklamieren, die »keinen Gehorsam gegenüber einer nicht menschlichen Autorität« kennt. »Doch diese vermeintlich radikale Ersetzung einer höheren Gerechtigkeit durch bloße menschliche Autorität droht eine Tyrannei der Mehrheit zu schaffen, die Konformismus zur zweiten Natur macht. Paradoxerweise ist Selbstdenken, die Zurück¬weisung der Autorität anderer, nur möglich, indem man einem höheren Gesetzt folgt, das nicht menschen¬gemacht ist.« (20) An dieser Stelle kommt der Monotheismus als Ursprung des Universa¬lismus ins Spiel, wobei B. ausdrücklich gegen Nietzsche, Freud und Assmann (der seine kritische Mono¬theismus-These allerdings weitgehend zurückgenommen hat) Stellung bezieht. Zentral ist für B. dabei die biblische Erzählung von der Bindung Isaaks. B. zufolge wurde »Kants ›kopernikan¬ische Wende‹ in Sachen Autorität« in Wirklichkeit von Abraham verkörpert (145). »Der Vater des Monotheismus verstand nur zu gut, dass Menschen die Lebewesen sind, die der Pflicht zur Gerechtigkeit folgen und aus diesem Grund kein Recht haben, zu gehorchen.« (145 f.) Dieser Satz fasst B.s Überzeugung knapp zusammen. Auf Martin Luther bezieht er sich dabei nicht, wohl aber auf Martin Luther King. Beide allerdings stellten sich letztlich unter die Autorität Gottes, um ihrer jeweiligen obrigkeitlichen Autorität zu widersprechen. Kann die Ersetzung der nicht¬mensch¬lichen Autorität Gott durch die nichtmenschliche Autorität der Idee einer universalen Gerechtigkeit als Wahrheitsbürge wirklich besser funktionieren? Sind nicht beide Autoritäten gleichermaßen offen für menschlichem Missbrauch oder wenigstens Missverstehen?
Das Buch hat drei Kapitel: 1. »Das Kainsmal«, 2. »Wahrheit als Volksfeind oder der Vorrang der Philosophie vor der Demokratie« und 3. »Die abrahamitische Unterscheidung oder was Aufklärung ist«. Gerahmt wird der Band von einem Prolog (»Vom Ursprung«) und einem Epilog (»Aus der Grube«), in denen das Thema gesetzt und dann einem Resümee unterzogen wird. Das rechte wie das linke Lager wetteifere darum, »den Maßstab des abstrakten Universalismus durch eine konkrete Identität zu ersetzen« (Prolog, 12). Aber letztlich sei es der Kampf der Identitäten, »die sich gegenseitig auslöschen«. Nur ein radikaler Universalismus könne sie verteidigen. Und dafür müsse man »den Geist der Menschen aus der Grube« befreien (Epilog, 155)
Kapitel 1 setzt mit dem US-amerikanischen Kampf gegen die Sklaverei ein. Aber es geht bald nicht mehr nur um die Tyrannei von Sklavenhaltern. Im Gefolge von Alexis de Tocqueville warnt B. vor der »Tyrannei der Mehrheit«. »In einer Demokratie kann die Neigung, sich der gängigen Meinung anzupassen […], die Freiheit von innen viel stärker bedrohen als die Herrschaft eines Monarchen von außen.« (31) Es kann dann passieren, dass »die Ideen von Freiheit und Gerechtigkeit selbst das Kainsmal« tragen (35) und die »Befreiung« durch die »Freiheit« ermordet wird. B. zitiert gegen Ende des Kapitels Martin Luther King, der den »guten Willen der Gemäßigten« verurteilt, weil er »für die Gerechtigkeit gefährlicher sei als der Ku-Klux-Klan«. Es gibt einen scheinheiligen – sprich liberalen – Universalismus. Und der trägt das Kainsmal (vgl. 67).
In Kapitel 2 werden die Probleme westlicher Demokratien, speziell die der US-amerikanischen, weiterführend verfolgt. B. setzt ein mit den »alternativen Fakten« Trumps und hält natürlich die »Verteidigung der Tatsachen« für unverzichtbar. Doch hält er fest, dass nicht nur populistische und nationalistische Politiker »falsche Tatsachen« als Waffe benutzen und »postmoderne Linke« die »Wahrheit mit den neuesten Theorien des Postkolonialismus oder der Critical Race Theory« attackieren, sondern auch »moderne Liberale« die Wahrheit »als Volksfeind« behandeln, »wenn die moralische Wahrheit einem bequemen Konsens widerspricht« (75). B. setzt auf den Vorrang der Wahrheit vor dem Konsens – der »Metaphysik vor der Verfassung« (84) und damit letztlich auf den Vorrang der Philosophie vor der Demokratie. Die Diskussionslinien hier sind höchst spannend und sollten dringend als Warnung verstanden werden. Wie sich jedoch B.s Intention eines Vorrangs der Philosophie vor der Demokratie und des Universalen vor dem Nationalen politisch verwirklichen lassen sollte, bleibt unklar.
Kapitel 3 nun ist das für Theologen interessanteste. B. versucht hier den universalen Anspruch des Gerechtigkeitsaxioms zu begründen, indem er den Monotheismus als Ursprung des Universalismus positiv aufnimmt, aber nicht zufällig ausgerechnet an der Gestalt Abrahams (dem »Glaubensheld«) säkularisiert. Kant fasse »Aufklärung« wie Spinoza als »Verweigerung der Autorität anderer über unser Denken«. Aber während Spinoza die Prophetie zurückweist, gebe Kants Modernisierung der Idee der Prophetie« uns »seine reifste Darstellung dessen, was Aufklärung ist« (125). Dabei stellt Abraham für B. die höchste Form der Prophetie dar, weil er sich in der Erzählung von der »Bindung Isaaks« (1. Mose 22,1–14) der Wahrheit und nicht dem Konsens unterwerfe, indem er Gottes Anweisung nicht befolgt und statt des Sohnes einen Widder opfert. Möglich ist diese Interpretation durch einen textkritischen Kunstgriff. B. erklärt die Verse 11 und 12 als nachträglichen Einschub, womit der Engel des Herrn, der dessen ursprüngliche Anweisung widerruft, entfällt. Das Messer in der Hand sieht Abraham den Widder und fasst den Entschluss, Gottes Befehl aus moralischen Gründen nicht zu folgen (140). Damit unterwirft er selbst die »einzig wahre Gottheit dem Moralgesetz« (135). Das ist die These.
Exegetisch hält die Rezensentin diese These nicht für haltbar, denn B. müsste nun auch die Verse 14–19 tilgen, sonst funktioniert der gesamte Text nicht mehr. Damit entfiele aber die für das Judentum zentrale Verheißung an Abraham. Nur im Verheißungskontext von 1. Mose 12 ff. erhält die Erzählung ihren verbindlichen kanonischen Sinn. Dass die Verse 11 und 12 ein frommer Zusatz seien, ist eine rein willkürliche Annahme, die schon erzähltechnisch nicht funktioniert. Es bedarf ja der Intervention des Engels, damit Abraham aufschaut, seinen Tunnelblick aufgibt und »hinter« sich blickt. Philosophisch könnte man argumentieren, dass sich Abraham nicht einfach einem gesellschaftlichen Konsens unterwirft, sondern Gott und damit der für ihn höchsten moralischen Autorität vertraut. Man versteht den Grundkonflikt der Erzählung nicht, wenn man in ihr eine »falsche« Autorität gegen die »richtige« stellt. Abraham befindet sich schlicht in einem Wertekonflikt. Die für Abraham höchste moralische Autorität Gott steht gegen die moralische Verantwortung, die Abraham für seine Sippe hat, wobei der Sohn des Patriarchen deren höchstes Gut ist. Dass Abraham den Sohn auch noch liebt, spitzt den Konflikt erzähltechnisch zu. Menschheitsgeschichtliche Großerzählungen wie diese haben aber immer verschiedene Ebenen. Die Hauptlinie der Erzählabsicht des verbindlich gewordenen Endtextes ist schlicht die, dass Abrahams radikales Vertrauen zum Ausgangspunkt der göttlichen Verheißung an Israel wird und sich Gott zum Bund mit Israel verpflichtet, ja sich an Israel bindet. Nicht die vermeintliche Verweigerung des Gehorsams gegen Gott ist der springende Punkt der Erzählung, sondern die Herausforderung Gottes durch Abraham, ob dieser nun zu seinen ergangenen Verheißungen steht oder nicht. Von hier aus wird verständlich, dass gerade Israels Propheten des Öfteren mit Gott rechten und hadern, worauf B. mit der Geschichte von Sodom und Gomorra (1. Mose 18) selbst hinweist. Nur versteht er sie als Abrahams Anlauf zum Ungehorsam (144). Doch um »Ungehorsam« geht es auch hier nicht, sondern darum, dass man mit einem Bundespartner durchaus handeln kann und sich Gott dabei als verlässlich erweist. Denn zwischen Gott und der Gerechtigkeit besteht keine Differenz, andernfalls wäre er nicht Gott. Insofern geht es auch nicht allgemein um menschliche Autonomie, wie Gustav Seibt in der SZ vom 30.3.2024 behauptet und Thomas Wagner in der FAZ vom 10.4.2024 aufnimmt. Das wird auch B. nicht gerecht, der ja, wie oben erläutert, die »radikale Ersetzung einer höheren Gerechtigkeit durch bloße menschliche Autorität« ablehnt.
Gelegentlich wird für die »Bindung Isaaks« auch eine religionsgeschichtliche Erzählebene bemüht, die in dieser Geschichte – auf Geheiß Gottes – die Abkehr vom archaischen Menschenopfer hin zum Tieropfer dokumentiert findet (anders noch bei Jephta und seiner Tochter, wo jedoch die Tocher der »Opferung« entflieht, indem sie dem Vater die schreckliche Entscheidung abnimmt und selbstbestimmt in den Tod geht). Es gibt aber eine andere Interpretation des »Opfers«, die konsequent theologisch argumentiert. Georg Steins, Professor für Biblische Theologie in Osnabrück, schreibt (https://blog.thomashieke.de/wp-content/uploads/2020/06/ks2025_s26f_WuK.pdf): »Wenn Abraham einen Widder ›anstelle seines Sohnes‹ opfert, ist das wörtlich zu nehmen: Das Tier vertritt den Sohn und alle seine Nachkommen, also das ganze Volk Israel.« Israel opfert mit dem Tier nicht »etwas«, sondern sich selbst, weil es weiß, »dass es sich ganz dem ›unmöglichen‹ Versprechen Gottes verdankt« (1. Mose 12,1–3) und sich darum symbolisch diesem Gott zurückgibt. Natürlich benutzen moderne Glaubenserzählungen, wenn sie zum Ausdruck bringen wollen, dass sich der Mensch ganz in der Hand Gottes befindet, eher Stoffe, die weniger verstören und möglichst ohne Gewalt auskommen. Doch das bedeutet nicht, dass eine säkularisierte Domestizierung alttestament-licher Texte im Kant-Boehmschen Sinn ihnen gerecht wird.
Überhaupt fragt sich, inwieweit man vom spezifischen Glaubenskontext bestimmter Texte absehen kann, ohne ihre Aussageintention zu verzerren oder ihre Gültigkeit infrage zu stellen. Letzteres gilt gerade für die US-amerikanische Unab¬hängigkeits¬erklärung. Vor dem Horizont ihres christlichen Selbstverständnisses versteht sie sich von selbst: »We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.« Doch ist diese »Wahrheit« noch »selbstevident«, wenn man diesen Kontext ausblendet? »Wo Menschen nicht als Geschöpfe, sondern als evolutionäres Zwischenresultat der Entwicklung der Säugetiere, psychische Systeme, neurobiologische Organismen oder Vorformen des Übermenschen verstanden werden, ist nichts von dem mehr einsichtig, was Artikel 1 als offenkundige Tatsache formuliert.« (Dalferth, Die Krise der öffentlichen Vernunft. Über Demokratie, Urteilskraft und Gott, Leipzig 2022, 250) Dem ist kaum zu widersprechen. Darum ist es wichtig und verdienstvoll, dass B. den Versuch unternimmt, mit Hilfe von Kant ein universales Moralgesetz für den säkularen Teil der Menschheit zu begründen, auch wenn dieses Vorhaben erkenntnistheoretisch teils ähnliche Probleme hat wie die religiöse Begründung. Letztlich sind wir alle Glaubende, ob wir nun an Gott oder eine wie auch immer ausgeführte Menschheitsidee unser Herz hängen. Wichtig allerdings ist, dass es keinen Ausschluss religiöser Gründe aus öffentlichen Debatten gibt, weil er die Vitalität der öffentlichen Debatten in der Demokratie verringert. Wenn die wichtigsten Überzeugungen von Menschen in öffentlichen Debatten keine Rolle spielen dürfen, werde der demokratische Diskurs oberflächlich (Michael J. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge 1998, 217).
In seinem Epilog berichtet B. von einer Freundin, die ihn – zweifelnd – nach den politischen Umsetzungsmöglichkeiten seiner humanistischen Vision fragt. »Sie sieht aus, wie die Republik Haifa«, schreibt er, »jene realistische binationale Utopie, die ich in einem früheren Buch entwickelt habe« (Boehm, Israel – eine Utopie, Berlin 2020). Nun ja, das dürfte auf absehbare Zeit in größerem Umfang nicht funktionieren, noch nicht einmal oder – nach dem Hamas-Terror im Oktober 2023 – schon gar nicht in Israel. Das schmälert aber nicht die Bedeutung dieses höchst menschen-freundlichen und anregenden Buches. Ein radikaler Universalismus könnte helfen, dass Menschen, in welchem Staatsgebilde auch immer, sich als Geschöpf ansehen, das sich im Letzten der Beziehung zum universalen Gott verdankt. Wer sich so als Geschöpf versteht, wird sich mit keinem Gesellschaftsgebilde restlos identifizieren, sondern die Distanz wahren, die nötig ist, um sich nicht über andere zu erheben. B.s universale »Pflicht zur Gerechtigkeit« ist in solchem Gottesverständnis eingeschlossen, aber von der vorauslaufenden göttlichen Gnade umfangen. Allerdings: Was ist mit Menschen, die auf Gott wie »universale Gerechtigkeit« pfeifen und im Gegensatz zu Kant die Moral nicht in sich selbst finden trotz des »gestirnten Himmels« über ihnen? Das »Gefühl« von Größe und Selbstwirksamkeit, das Kant als menschliches Staubkorn angesichts des Universums in der Moral fand, finden andere in der Unmoral – und sind stolz darauf. Hier kommt ins Spiel, was Christen Sünde nennen: die Verneinung der Geschöpflichkeit.
Darum werden Philosophen ebenso wenig wie Theologen Mensch und Welt grundsätzlich moralisch bessern können. Aber um hilfreiche Ansätze zu entwickeln für den Fortbestand der Menschheit – durchaus dem biblischen Herrschaftsauftrag von 1. Mose 1,28 entsprechend – bedarf es zu jeder Zeit regulativer Ideen, die mehr oder weniger untergründig über lange Zeiträume hinweg wirken. Eine solche regulative Idee stellt B. in der Nachfolge Kants vor. Kant wiederum kannte natürlich Paulus, der schon vor knapp 2000 Jahren schrieb: »Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.« (Galater 3,28) Schon der Jude Paulus, der zum ersten großen christlichen Theologen wurde, negiert jedes identitäre Denkmuster, sei es auf die Nation, den sozialen Status oder das Geschlecht bezogen. Dass dieser Satz heute noch so aktuell ist wie damals, könnte einen verzweifeln lassen, wüsste man nicht, dass er immer wieder engagierte Verfechter findet, seien sie religiös oder säkular grundiert. Auf ein Letztes muss dringend noch hingewiesen werden: Obwohl das Judentum kaum missionarisch agiert, ist es im Blick auf die Anerkenntnis des einen Gottes universal – und die Menschheit verdankt ihm die Idee der Zentralstellung von Gerechtigkeit.
Annette Weidhas (Leipzig)